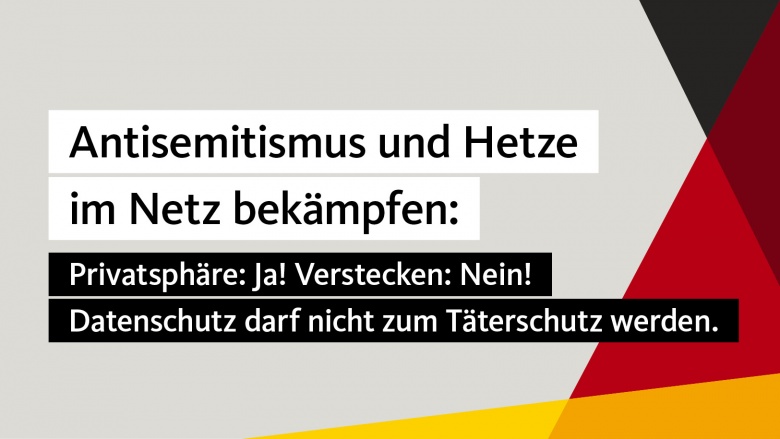
- Bei Facebook teilen
- Bei Twitter teilen
- Bei Whatsapp teilen
- Per Messenger teilen

Antisemitismus und Hetze im Netz bekämpfen
Die Anzahl antisemitischer Online-Kommentare hat sich zwischen 2007 und 2018 verdreifacht – so das Ergebnis einer Langzeitstudie der TU Berlin. Begleitet wird diese besorgniserregende Entwicklung antisemitischer Anfeindungen zudem auch von einer Zunahme realer Gewalt gegen Jüdinnen und Juden: Der „digitale“ Antisemitismus in Diskussionsforen, Kommentarbereichen und sozialen Netzwerken setzt sich vermehrt auch im analogen Raum fort.
Hass und Hetze im Netz sind für viele Menschen in Deutschland zu einem ganz realen Problem geworden. Politiker klagen über Anfeindungen und Drohungen oder leben mit ihren Familien in Angst vor Übergriffen. Denn dass digitaler Hass in Gewalt umschlagen kann, hat nicht zuletzt die grausame Ermordung des Kasseler Regierungspräsidenten und CDU-Politikers Walter Lübcke gezeigt. Auch das Bundeskriminalamt misst der Thematik große Bedeutung bei und beschäftigt sich auf der derzeit laufenden Herbsttagung damit.
Für die CDU ist klar: Hass, Hetze und Antisemitismus im Netz sind eine Bedrohung für die Demokratie und müssen hart bekämpft werden. Dazu wurden die Sicherheitsbehörden in den vergangenen Jahren personell, materiell und strategisch gestärkt – mit besonderem Fokus auf Verbesserungen bei Polizei und Verfassungsschutz zur Bekämpfung von Extremismus und Terrorismus. Eine weitere besondere Herausforderung ist die Verlagerung der Kommunikation ins Internet. Hass und Hetze, Fake News und Propaganda spielen eine große Rolle. Auf verschiedenen Ebenen und von verschiedenen Stellen werden hier bereits unterschiedliche Ansätze verfolgt. Klar ist, dass die sozialen Medien niemals vollständig kontrolliert werden können und sollen. Eindeutig rechtsextremistische Inhalte und deren Urheber müssen erkannt, strafrechtlich relevante Inhalte noch effizienter bekämpft und Urheber verfolgt werden. Die CDU unterstützt die Initiativen von Polizei und Verfassungsschutz in diesem Zusammenhang ausdrücklich.
Zudem sind repressive Elemente wichtig: Straftaten müssen lückenlos aufgeklärt werden – dazu müssen die Sicherheitsbehörden deutschlandweit noch besser zusammenarbeiten. Zum Beispiel sollen künftig nicht nur sog. Gefährder, die ihren Wohnort wechseln, automatisiert an die zuständige Staatsschutzstelle übergeben werden, sondern auch polizeibekannte politisch motivierte Straftäter.
Dazu müssen auch die Instrumente der Sicherheitsbehörden auf der Höhe der Zeit sein. Die digitalisierte Welt stellt große Herausforderungen an die Sicherheitsbehörden dar. Verfassungsschutz und Polizei dürfen Extremisten und Verbrechern dabei nicht hinterherhinken. Das bedeutet, dass die Chancen der Digitalisierung genutzt werden müssen. Dies umfasst neben der Einführung neuer Software zur Analyse und Auswertung von „Bigdata“, der Online-Durchsuchung und Quellen-Telekommunikationsüberwachung auch Instrumente wie die sog. Vorratsdatenspeicherung und -nutzung, die für Verfassungsschutz und Polizei wichtig sind.
Datenschutz darf nicht zum Täterschutz werden. In Bezug auf das Thema Erkennen und Bekämpfung von Hasskriminalität bedarf es in besonders schweren Fällen von Verleumdung/ Beleidigung Ermittlungen der Strafverfolgungsbehörden, die gegebenenfalls auch ohne Anzeige eingeleitet werden können. Betreiber von Plattformen sollen dazu verpflichtet werden, strafrechtlich relevante Inhalte bei den Strafverfolgungsbehörden zu melden. Hierzu muss das Netzwerkdurchsetzungsgesetz erweitert werden. Zudem soll auf Plattformen mit strafbarem Inhalt keine Werbung mehr geschaltet werden. Löschen die Betreiber bedenkliche Inhalte nicht, sollen diese zumindest mit einem Warnhinweis für die Nutzer versehen werden.
Hinsichtlich der Speicherung auffälliger Personen sollen Löschfristen ausgedehnt werden, um zu verhindern, dass Extremisten unter dem Radar verschwinden, nur weil sie für einen gewissen Zeitraum „unauffällig“ sind. Daneben hält die CDU eine Verlängerung der DNA-Speicherfristen über 10 Jahre hinaus für notwendig, damit Spuren zur Aufklärung schwerer Straftaten nicht verloren gehen
Darüber hinaus sollen präventiv und beratende Instrumente in Zusammenarbeit von Bund, Ländern und Kommunen gestärkt werden. Bürgerinnen und Bürger sollen wieder stärker „für“ unseren Staat gewonnen werden. „Nur wenn der Zusammenhalt der Gesellschaft aktiv als ständige Aufgabe aller Bürger und gesellschaftlichen Akteure begriffen wird, wirkt diese Gesellschaft auch nach innen integrativ“, heißt es in einem gemeinsamen Beschluss der Bundesfachausschüsse „Gesellschaftliche Zusammenhalt“ und „Innere Sicherheit“ von September 2019.
Link zur Studie: http://www.buendnis-toleranz.de/service/aktiv/veranstaltungen/174618/judenhass-2-0-strategien-gegen-antisemitismus-im-netz
